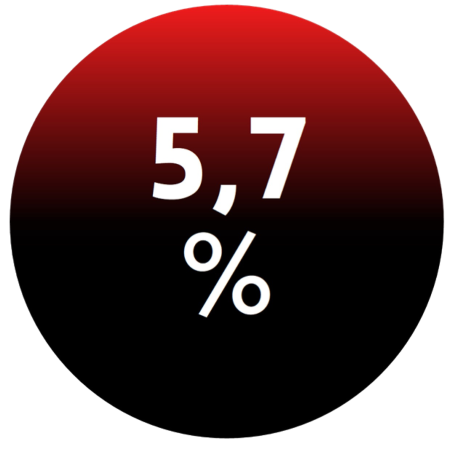Reformen,
Reformen,
Reformen.
Für das Wirtschaftswunder 2.0 ist nationales Change Management überfällig. Es erfordert Reformen, Reformen, Reformen, um Wirtschaftswachstum zu organisieren.
Multiple Krisen erfordern multiples nationales Change Management, das das Geschäftsmodell reformiert.
Deutschland 4.0 als „Auslaufmodell“ muss als „Deutschland 5.0 zu einer Plattform für ein neues Wirtschaftswunder werden, damit sich Deutschland auch künftig seinen Wohlfahrtstaat leisten kann und will.
Reform
"Made in Germany" als Nationalmarke
Es gilt, "Made in Germany" mit dem Markenkern der sozialen Marktwirtschaft in der Verfassung zu verankern.
Wenn man Nation Branding als Markenführung für Staaten und damit in der Politik ernst nimmt, sind Markenkern und zentrale Markenattribute klar zu benennen sowie verfassungsrechtlich zu verankern, damit sich die Wirtschaftsgesellschaft danach richtet.
Zugleich wird die soziale Marktwirtschaft einklagbar.
Politische Interventionen wie Mindestlöhne, Mietpreisbremsen und andere Maßnahmen, die Märkte durch Planwirtschaft ersetzen, wären nicht mehr zulässig.
Reform
Der Staat als Rahmengeber
Der Staat hat sich vom Ordnungsstaat zum Leistungsstaat entwickelt
In dieser Entwicklung ist ein zentraler Treiber der multiplen strategischen Krise des Wirtschaftsstandorts zu suchen. Er führt mit der so genannten „Produktivitätslücke“, die den Abstand der Produktivität privater und öffentlicher Wirtschaftsleistung beschreibt.
Wenn der Staat durch Steuer- und Abgabenquoten und Bürokratie den Standort in die Krise geführt hat, muss er seine politische Strategie ändern.
Darum muss der Staat sein Leistungsverständnis wieder auf die Ordnungspolitik konzentrieren, wenn er ein Wirtschaftswunder organisieren will.
Allein hier ergibt sich ein komplexes Handlungsfeld für die Juristen in den Parlamenten und Regierungen.
Reform
Traditionsparteien
neu aufstellen
Es ist erstaunlich, dass an die Traditionsparteien der Demokratie keine ernsthaften Reformforderungen gestellt werden.
Jedenfalls verlieren die Traditionsparteien seit Jahrzehnten an Mitgliedern und Zustimmung. Zudem haben die (Regierungs-)Parteien aus Deutschland den führenden Wohlfahrtsstaat gemacht und ihn zu gleich zum Wirtschaftspatienten Europas.
Parteien müssen Problemlöser werden.
Wie die Parteien den Markenkern der sozialen Marktwirtschaft pflegen, überlässt der Statt als Rahmengeber den Parteien.
Aber: Interventionen sind nun nur im Ausnahmefall zulässig. Sie haben nun die soziale Marktwirtschaft wieder herzustellen.
Ein weiterer Ausbau des Sozialstaats ist bis auf Weiteres tabu, da sich hiermit kein Wirtschaftswachstum organisieren lässt.
Reform
Dezentralität und Wettbewerb
Die soziale Marktwirtschaft setzt zuerst auf die Koordinationskraft der Märkte: für Unternehmen, aber auch die öffentliche Hand.
Der Föderalismus bietet eigentlich die Möglichkeit, den Wettbewerbsgedanken zwischen den Gebietskörperschaften einzuführen.
Es gibt in Deutschland aber keinen echten föderalen Wettbewerb. Im Gegenteil: er blockiert sich selbst.
Dafür sind eine zu starke Zentralisierung der Gesetzgebungskompetenz, fehlende Steuerautonomie, überlappende Zuständigkeiten oder Mischfinanzierungen verantwortlich.
Hinzu kommen Finanzausgleichsregelungen, die zusätzliche Steuereinnahmen fast vollständig abschöpfen.
Wettbewerbliche Mechanismen werden also künstlich beseitigt und durch eine sich selbst verstärkende Bürokratie ersetzt. Dies ist die Politik der staatlichen Sozialwirtschaft.
Ein Fokus notwendiger Reformen wird in derStärkung des Föderalismus bestehen, schon um die öffentliche Hand effektiver zu machen und Bürokratie abzubauen.
Reformen, Reformen, Reformen
Der Staat muss seine Ausgaben senken. Der Staat ist der größte Unternehmer, und die Staatsquote liegt bei rund 50 Prozent.
Der Staat beitreibt Medien, ist Arbeitsvermittler, ist der Gesellschafter der Deutschen Bahn, betreibt Bauämter und ist zum Allround-Versicherer geworden.
Mit sozialer Marktwirtschaft hat Deutschland 4.0 wenig zu tun. Wirtschaftswunder erfordert Wirtschaftsleistung: Politik muss nicht nur jede Behörde, sondern jede staatliche Aufgabe auf den Prüfstand stellen.
Reform
Der ehrbare Staat
Das Leitbild des ehrbaren Kaufmanns, der fair, verantwortlich, vorsichtig und transparent wirtschaftet, wird als Markenkriterium auf die soziale Marktwirtschaft als „ehrbarer Staat“ übertragen.
Das heißt für die gesamte Politik der Mitte, dass Ausgaben den einnahmen anzupassen sind - und nicht die Einnahmen immer neuen Ausgaben.
Angesichts von neuen und alten Rekordschulden, muss die Politik ihr Politikverständnis radikal ändern.
Nicht immer neue Ausgaben, sondern immer neue Einsparideen müssen sie prägen, solange Politik durch Schulden investive Politik einschränkt und zugleich private Wirtschaft verdrängt.
Wirtschaftswachstum erfordert angebotsorientierte Politik in Form von verbesserte Standortbedingungen. Ein Staat kann seine Strukturkrise nicht mit nachfrageorientierter Politik lösen.
Die Kampagne Wirtschaftswunder 2.0 unterstützt Politiker mit Seminaren und Coaching, um Wirtschaftskompetenz aufzubauen.
Reform
Wirtschaftsidentität wiederbeleben
Ein positiver Stolz auf die Wirtschaftsleistung prägte einst die Wirtschaftsidentität. Politik, Medien und auch Schulen müssen sie wiederbeleben.
Das Kernstück der deutschen Wirtschaftsidentität ist die Akzeptanz und Wertschätzung des Wirtschaftsmodells der Sozialen Marktwirtschaft.
Die Wirtschaftsidentität ermöglichte der deutschen Bevölkerung auf breiter Basis einen Wohlstand zuvor nicht gekannten Ausmaßes:
Das war das
Wirtschaftswunder 1.0.
Wenn der Standort ein neues Wirtschaftswunder organisieren will, muss er seine Wirtschaftsidentität als Selbstverständnis der Nation wiederbeleben.
Reform
Deregulierung
Um die Bedingungen des Wirtschaftsstandorts zu verbessern, muss der Staat seine Regulierungsintensität senken, also dauerhafte Interventionen staatlicher Instanzen in marktliche Prozesse abbauen.
Typische Regulierungen betreffen beispielsweise die Preisbildung (z.B. Mietpreisbremse) oder Marktzugänge (z.B. Lizenzen als Marktzugang).
Regulierungen sind zum Teil mit öffentlichen Unternehmen eng verbunden, beispielsweise der Bahn, Medien oder Energieunternehmen. Damit gehört auch die Privatisierung öffentlicher Unternehmen zur Deregulierung
Es erfordert Expertenwissen, „Made in Germany“ mit Deregulierung wettbewerbsfähiger zu machen.
Das sozialpolitische Argument der "staatlichen Daseinsvorsorge" für Regulierung ist allerdings für viele Bereiche veraltet:
Wer sich das Staatsunternehmen Deutsche Bahn anschaut und dies mit der privatisieren Deutschen Telekom vergleicht, der erkennt, wie schwer es dem Staat fällt, besser zu arbeiten als es Wirtschaftsunternehmen können.
Die Expertenherausforderung für das neue Wirtschaftswunder besteht darin, ordnende Rahmenbedingungen für deregulierte Unternehmen und Märkte zu schaffen. Politik muss hierfür die erforderlichen Prozesse anstoßen.
Reform
Bürokratieabbau
Die Wirtschaftsordnung, die dem Staat in der sozialen Marktwirtschaft Zurückhaltung verordnet und den Wettbewerb schützt, erfordert eine durchschlagende Justiz und damit Bürokratie.
Das aktuelle Bild von Elon Musk, der als Beauftragter der US-Regierung symbolisch die Kettensäge für den Bürokratieabbau schwingt, ist mit Blick auf die notwendige Bürokratie populistisch.
Bürokratie ist nicht per se negativ. Sie dient der Rechts- und Planungssicherheit.
Bürokratie meint auch Informations- und Dokumentationspflichten: von der Erstellung von Rechnungen bis zu Inventuren und Steuererklärungen.
Die Politik selbst schafft Bürokratie: Die Lösung vermeintlich neuer Probleme führt zu neuen Gesetzen und Regulierungen.
Wenn Politik das Wirtschaftswunder 2.0 organisiert, muss sie Bürokratie strategisch reduzieren, z.B.:
• Prozentuale Budgetkürzung, um Staat und damit Bürokratie schrittweise zurückzuführen
• Rückbau und zeitliche Beschränkung staatlicher Leistungen, Ansprüche und Regulierungen
• Praktikabilitätscheck neuer und bestehender Gesetze und Vorschriften
• Zusammenlegung von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien
Intelligenter Bürokratieabbau ist für sich eine Herausforderung für alle Handlungsfelder der Politik.
Reformen, Reformen, Reformen
Der Politik und Deutschland 4.0 wird sein Jahrzehnten Strategielosigkeit und Reformblockaden attestiert.
Die Politik für ein neues Wirtschaftswunder ist nicht nur eine Vision, sondern gibt die Priorität für die aktuelle 21. Legislaturperiode des Deutschen Bundestags und aller Landesparlamente.
Reform
Rückbau des Sozialstaats
Der Wohlfahrtsstaat ist, Problemlöser und Problemverursacher: Er hat die Nation stabil und gerechter gemacht.
Die heutige Krise des Wohlfahrtsstaat ist das Ergebnis von zwei Jahrhunderten Gesetzgebung, die den Staat zum Allround-Versicherer mit einer Sozialversicherung mit Arbeitslosen-, Renten-, Kranken-, Unfall- und Pflegeversicherung und zusätzlich einer sozialen Grundsicherung gemacht hat.
Seit den 1960er Jahren sind die Sozialausgaben im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt von gut 18 auf über 30 Prozent (2023) gestiegen.
Der Wohlfahrtstaat ist damit Ursache vieler Krisen, da er (zu) viele Staatseinnahmen bindet.
Wenn der Sozialstaat kritisiert wird, setzt in der Regel ein politisch-mediale Aufregungsritual ein.
Das Narrativ des neoliberalen Marktwahnsinns wird mit all seinen Facetten, vom Turbokapitalismus bis zum Abriss des Sozialstaats, in allen Kanälen befeuert.
Wenn hier von „Rückbau“ die Rede ist, ist eine Rückbesinnung auf die Idee der sozialen Marktwirtschaft: Wirtschaftsleistung für Wohlstand.
Die Idee der sozialen Marktwirtschaft,
Wohlstand für alle zu ermöglichen, bedeutet keine Vorfahrt für die Sozialpolitik.
Im Gegenteil stehen Wettbewerb und Märkte im Fokus.
Ein neues Wirtschaftswunder erfordert, den Sozialstaat zurück zu bauen - und nicht immer weiter auszubauen.
Reform
Staatliche Effektivität und Effizienz
Die öffentliche Hand wächst stärker als die Bevölkerung.
Nur ein Beispiel ist der Bund: Die Personalausgaben sind von 29,9 Milliarden (2015) auf 42,4 Milliarden (2024) Euro gestiegen.
Der Staat verdrängt die private Wirtschaftstätigkeit und verschärft das Problem des Fachkräftemangels, da die öffentliche Hand als weniger effizient gilt als die private Wirtschaft.
Alle staatlichen Institutionen gehören mit zwei Reformansätzen auf den Prüfstand:
- Funktionalreform: Neuzuordnung von Aufgaben und Zuständigkeiten zwischen bestehenden Verwaltungen
- Territorialreform: Prüfung des territorialen Zuschnitts von gebietsbezogenen Verwaltungseinheiten wie Gebietskörperschaften (z.B. Gemeinden und Kreise).
Die Parteipolitik ist gefordert, jede öffentliche Institution zu prüfen, ob ihre Aufgabe nicht genauso gut oder besser privat zu leisten wäre.
Ist die öffentliche Betätigung in der sozialen Marktwirtschaft erforderlich ist sie auf Effizienz zu prüfen.
Nach Schlagworten wie der „schlanke Staat“ oder der „aktivierende Staat“ gibt es derzeit aber kein dominierendes Reformparadigma, an dem sich Reformer orientieren könnten.
Jede Behörde braucht
Optimierungsprogramme, die Verwaltungen und Experten gemeinsam erarbeiten.
Mit dem zentralen Markenwert „Markt vor Staat“ skizziert die Nationalmarke "Made in Germany" eine Politikagenda fürReformen der öffentlichen Hand.
Reform
Digitalisierung der öffentlichen Hand
Der aktuelle Digitalisierungszustand des Staates wird zum Teil als „bedenklich“ eingestuft. Das ist nicht nur aus Effizienzgründen problematisch, sondern hemmt auch die Wirtschaftsverwaltung.
Die Digitalisierung kann den Reformbedarf unterstützen, um Kapazitätsengpässe und Verwaltungsaufwand der öffentlichen Hand zu senken.
Diskussionen zu „Smart Government“ zeigen, dass Digitalisierung mehr als nur „IT“ ist, sondern auch strategisches Potenzial für Verwaltung und Politik beinhaltet, beispielsweise beim selbstgesteuerten Datenaustausch mit Bürgern und zwischen Verwaltungen.
Der Begriff „E-Goverment“ ist inzwischen rund ein Vierteljahrhundert als. Er kann in Anlehnung an „E-Business“ als Digitalisierung von Prozessen in und mit der öffentlichen Hand verstanden werden.
Das Ziel der Verwaltungsdigitalisierung besteht darin, den Bürokratieaufwand bei Unternehmen, Beschäftigten und Bürgern zu verringern, öffentliche Leistungen effizienter bereitzustellen und ihre Qualität und Geschwindigkeit zu erhöhen.
Um die Geschwindigkeit der Einführung zu erhöhen, wird angemahnt, dass der Bund seine Führungsrolle stärker wahrnehmen muss.
Aus Sicht des Nation Branding ist die Digitalisierung ein wichtiges Handlungsfeld, um den Transformationsprozess für Deutschland 5.0 strukturiert voranzutreiben.
E-Business hat das Potenzial Geschäftsmodelle zu aktualisieren. Gleiches gilt für die öffentliche Hand. „Smart Government“ mit einer „intelligenten Vernetzung“ von Verwaltungen – nach innen und mit Bürgern – könnte die Modernisierung vorangetrieben werden (von Lucke, 2016).
Reform
Privatisierung
Mit der Deregulierung, der Effizienzsteigerung der öffentlichen Hand und dem Abbau der Bürokratie gehört auch die Privatisierung, also die Entstaatlichung öffentlicher Institutionen.
Aus Effizienzgründen und dem Dynamikpotenzial der privaten Wirtschaft ist der Entstaatlichung Vorfahrt zu gewähren.
Allerdings unterscheiden sie die Aufgaben öffentlicher Institutionen erheblich und damit auch die Frage, ob und inwieweit in der sozialen Marktwirtschaft aktiv werden sollte: Der Staat betreibt Arbeitsvermittlung, Bahn, Bauämter, Krankenhäuser, Sender (ARD, ZDF) und vieles andere mehr.
Politik als Nationalmarkenmanagement ist gefordert, dort zu privatisieren, womit das Wachstum gefördert und nicht der Leistungsstaat, insbesondere der Wohlfahrtstaat erste Priorität haben sollte.
©Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.